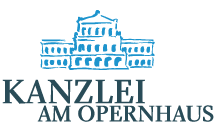Die Verpflichtung zur Belegvorlage beschränkt sich auf die Vorlage vorhandener Nachweise. Dies hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 01.12.2021 (XII ZB 472/20) entschieden. Demnach besteht keine Pflicht zur Erstellung von Belegen, die über die bloße Kopie bereits existierender Unterlagen hinausgeht und eine eigene schöpferische Leistung erfordert.
Die im Verfahren beteiligten Eheleute heirateten 2003 und machten im Rahmen des Scheidungsverfahrens wechselseitig Ansprüche auf Zugewinnausgleich im Wege von Stufenanträgen geltend, wonach zunächst Auskunft zu den Stichtagen zu erteilen war. Der Ehemann legte den Gesellschaftsvertrag einer GbR vor und erklärte, den Wert seines Anteils an der GbR nicht zu kennen. Ob ein Jahresabschluss für 2016 für die GbR erstellt wurde, war zwischen den Beteiligten streitig.
Das Familiengericht hatte den Ehemann verpflichtet, Auskunft hinsichtlich seines Gesellschaftsanteils an einer GbR durch Vorlage des Jahresabschlusses für 2016 zu belegen. Hiergegen wandte sich der Ehemann mit der Beschwerde. Auch im Rahmen des Beschlusses des Oberlandesgerichts Düsseldorf blieb er verpflichtet, seine Auskunft bezüglich seines Anteils an einer GbR durch Vorlage des Jahresabschlusses für 2016 zu belegen. Anlässlich seiner Rechtsbeschwerde hatte nunmehr der Bundesgerichtshof über die Pflicht zur Belegvorlage zu entscheiden. Demnach beschränkt sich die Vorlagepflicht auf bereits vorhandene Belege.